INDIS-Nachhaltigkeits-Challenges 2025/26
INDIS – takes action for Sustainability
Während des INDIS-Zyklus werden Lösungsideen für INDIS-Nachhaltigkeits-Challenges entwickelt. Grundlage sind die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der UN.
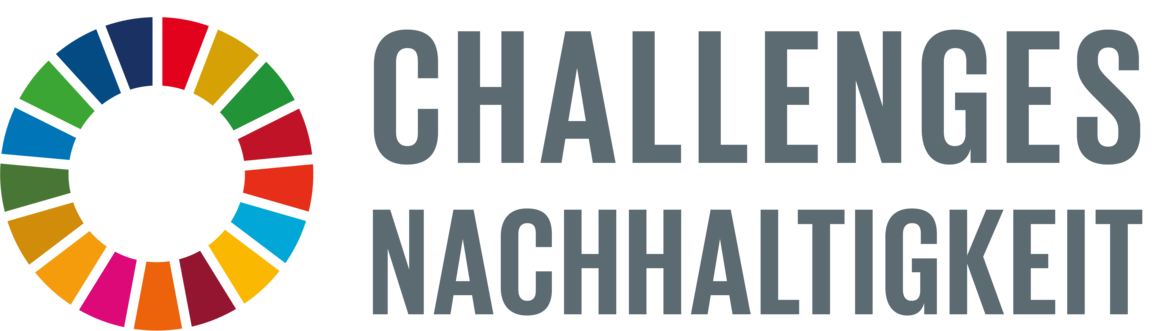
Arbeit in den interdisziplinären INDIS-Teams
Die interdisziplinären INDIS-Teams bestehen aus drei bis sechs Studierenden aller Standorte und Fakultäten/Studienbereiche (Wirtschaft, Technik, Sozialwesen und Gesundheit). Es geht darum, Wissen zu teilen und gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln. Jedes Team erhält bei der Bearbeitung der Challenge Unterstützung über ein individuelles Coaching durch das INDIS.
In allen INDIS-Teams werden Artefakte in folgenden Bereichen erstellt:
- Anforderungsanalyse
- externer Expertenkontakt
- Dokumentation
- 2-3 Pitches
- Testen der Artefakte
- ein finales digitales, haptisches oder handlungsorientiertes Artefakt
Die INDIS-Nachhaltigkeits-Challenges 2025/26
Die Studierenden können sich in den INDIS-Teams entweder mit den vorgeschlagenen Challenges beschäftigen oder eine eigene Challenge verfolgen.
Die Studierenden können selbst als Challengesetter:in eine eigene Challengeidee einbringen oder entwickeln, die die Perspektiven aller Fakultäten und Fachgebiete (Wirtschaft, Technik, Sozialwesen und Gesundheit) berücksichtigt. Diese kann im Vorfeld eingereicht und beim Kick-off-Event möglichen Mitstreiter:innen präsentiert werden. Die Umsetzung der eigenen Challengeidee kommt nur zustande, wenn sich ein interdisziplinäres Team dafür zusammenfindet.
SDGs: 11, 12, 13
Challenge: Wie kann die DHBW oder ihre Dualen Partner Anreize schaffen, um klimafreundliche Mobilität zu fördern – im Alltag von Studierenden und Mitarbeitenden? Gesucht werden innovative Ansätze, die Pendelverhalten nachhaltig verändern, CO₂-Emissionen reduzieren und gleichzeitig praktikabel, attraktiv und wirtschaftlich umsetzbar sind.
Ziele: Psychologische Analyse und Entwicklung eines innovativen Anreizsystems zur Förderung nachhaltiger Mobilität für die DHBW oder einen Dualen Partner – mit Blick auf Wirksamkeit, Akzeptanz und langfristige Umsetzbarkeit.
Artefakt: Ein Konzept oder Prototyp für ein Anreizsystem zur emissionsarmen Mobilität – skalierbar und adaptierbar. Dieses sollte mit einem kleinen Panel an Nutzenden an DHBW Standorten oder bei Dualen Partnern über einen bestimmten Zeitraum erprobt werden.
Kooperation: Prof. Dr. Wolfgang Habla (DHBW VS)
Ansprechperson: Dr. Marcella Rosenberger
SDGs: 3, 9, 10
Challenge: Autonomie ist ein zentrales Bedürfnis – auch und gerade im Pflegekontext. Menschen mit körperlichen Einschränkungen, etwa nach einem Unfall oder bei Behinderung, möchten alltägliche Aktivitäten möglichst selbstständig ausführen können. Besonders herausfordernd ist der Weg zur Toilette, wenn dieser nur mit Hilfsmitteln wie einem Toilettenstuhl möglich ist. Oft fehlen Platz oder Personal, um diesen jederzeit bereitzustellen. Wie kann Technik helfen, die Selbstständigkeit in solchen Situationen zu wahren und damit die Lebensqualität deutlich zu erhöhen?
Ziele: Entwicklung eines autonomen Assistenzsystems – ein „rufbarer“ Toilettenstuhl, der selbstständig zur betroffenen Person navigiert und so Unterstützung im Alltag bietet. Ziel ist es, ein leichtes, manövrierfähiges System mit intelligenter Sensorik und intuitiver Mensch-Maschine-Schnittstelle zu gestalten. Neben technischer Umsetzbarkeit stehen auch Fragen der Alltagstauglichkeit, Nutzerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, soziale und persönliche Auswirkungen im Fokus.
Artefakt: Prototyp eines autonomen Toilettenstuhls mit funktionaler Navigation und Nutzerinteraktion
Kooperation: Prof. Dr. Dirk Reichardt (DHBW Stuttgart, Zentrum für Künstliche Intelligenz)
Ansprechperson: Judit Klein-Wiele
SDGs: 4, 16
Challenge: Demokratie ist die Grundlage für eine gerechte und freie Gesellschaft, aber sie kann durch mangelnde politische Bildung, Desinformation, Extremismus und das Schwinden von bürgerschaftlichem Engagement bedroht werden. Wie kann Kunst als wirkungsvolles Mittel zur Stärkung demokratischer Werte eingesetzt werden? Ziel ist es, ein interaktives Kunstprojekt zu entwickeln, das Menschen auf kreative Weise für demokratische Prinzipien sensibilisiert und sie zu eigenem Engagement motiviert. Die Kunstprojekte sollen demokratische Themen erlebbar machen, Diskussionen anstoßen und unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen aktiv einbinden – sowohl analog als auch digital.
Ziele: Konzeption, Gestaltung und Umsetzung eines inklusiven und partizipativen Kunstprojekts, das das Bewusstsein für demokratische Werte stärkt, den kritischen Diskurs fördert und kreative Ausdrucksformen für gesellschaftliches Engagement bietet. Über (VR-) Ausstellungen, Kunstinstallationen, Workshops und digitale Medien sollen verschiedene Zielgruppen erreicht, zum Mitgestalten angeregt und neue Impulse für den Erhalt und die Weiterentwicklung einer lebendigen Demokratie gesetzt werden.
Artefakt: Kunstprojekte zur Demokratie mit öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen
Kooperation: Kunst der Demokratie (INDIS-Zyklus 2024/25)
Ansprechperson: Judit Klein-Wiele, Susanne Völkle (Studierende)
SDGs: 9, 10, 11
Challenge: Wie können KI-gestützte Mobilitätslösungen gerechter gestaltet werden, speziell für Menschen, die von bestehenden Systemen benachteiligt sind? Gesucht werden Innovationen, die Mobilität im Alltag für z. B. Alleinerziehende, Senior:innen oder Nachtarbeiter:innen zugänglicher, sicherer und inklusiver machen.
Ziele: Analyse bestehender KI-basierter Mobilitätsdienste im Hinblick auf Fairness und Zugangshürden. Entwicklung eines quartiersnahen, sozial gerechten Mobilitätskonzepts mit KI-Komponente – nutzerzentriert, realitätsnah und adaptierbar.
Artefakt: Ein Konzept oder Prototyp für eine gerechte, KI-gestützte Mobilitätslösung – getestet mit einer Zielgruppe (z. B. Pflegekräfte, Rentner:innen) in einem konkreten Anwendungsraum (z. B. Stadtteil, Pendelroute, ländlicher Raum). Analysebericht bestehender Systeme mit Verbesserungsvorschlägen.
Kooperation: Projekt CITAI (Madeleine Neumann, Sinu Thiruketeswaran) und ggf. Sozialverbände, Stadtverwaltungen, Mobilitätsanbieter, Quartiersinitiativen
Ansprechperson: Prof. Dr. Marc Kuhn
SDGs: 7, 10, 11, 12, 13, 15
Challenge: Wie kann Umweltpolitik erfolgreich sein – ökologisch sinnvoll, sozial gerecht und von der Bevölkerung akzeptiert? Viele notwendige Maßnahmen erfahren Widerstand. Das in dieser Challenge zu entwickelnde GreenLab bietet einen realen Raum auf dem Campus, um innovative und sozialverträgliche Klimaschutzlösungen zu entwickeln, zu erproben und erfahrbar zu machen. Es dient als Testfeld, um zu verstehen, wie eine Transformation gelingen kann, die Menschen in ihren verschiedenen Lebensbereichen mitnimmt.
Ziele:
- Das GreenLab soll konkrete Beiträge zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf dem Campus leisten und gleichzeitig als lebendiger Lernort dienen.
- Im GreenLab werden innovative Technologien und Ansätze entwickelt und evaluiert, die sowohl ökologisch wirksam als auch sozial gerecht sind und die Resilienz des Campus stärken.
- Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem GreenLab fließen in die kritische Bewertung aktueller umweltpolitischer Instrumente (z. B. CO₂-Steuer) hinsichtlich ihrer Wirkung und sozialen Fairness ein.
- Ziel ist die Entwicklung umfassender Strategien für eine sozial akzeptierte und zukunftsfähige grüne Wende, basierend auf den praktischen Erfahrungen und Modellen des GreenLabs, wobei Akzeptanz und Teilhabe im Vordergrund stehen.
Artefakt: Ein etabliertes GreenLab auf dem Campus mit ersten nachhaltigen und konkreten Pilotprojekten. Es dient als wegweisendes Modell für angewandten Klimaschutz an Hochschulen und liefert evaluierbare Erkenntnisse für die Gestaltung einer sozial gerechten grünen Wende in einem größeren Kontext.
Kooperation: Klimamanager:innen der DHBW, Green Offices der DHBW, Prof. Dr. Wolfgang Habla, Prof. Dr. Martina Wanner
Ansprechpersonen: Prof. Dr.-Ing. Harald Mandel, Dr. Marcella Rosenberger
SDGs: 4, 10, 16
Challenge: Kids Cube ist ein partizipatives Projekt in Kooperation mit der DHBW Stuttgart und der AWO Stuttgart. Es stärkt die Teilhabechancen geflüchteter Kinder, indem ihre Bedürfnisse und Ideen in die kindgerechte Gestaltung ihres unmittelbaren Lebensumfelds einfließen. Im neuen Jahreszyklus liegt der Fokus auf der kreativen und technischen Weiterentwicklung der sechs pädagogischen Module: Empowerment, soziale Teilhabe, politische Bildung, Medienkompetenz, Prävention/Gesundheit und Kinderrechte. Die Kinder sollen spielerisch an Technik herangeführt und in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden. Gesucht werden engagierte Studierende mit Freude an interdisziplinärer Teamarbeit, Eigenverantwortung und sozialem Engagement. Erwartet werden mindestens acht regelmäßige Präsenztermine, um Verlässlichkeit und Kontinuität zu gewährleisten.
Ziel: Die Studierenden entwickeln gemeinsam mit Kindern (8–12 Jahre) kleine technische Artefakte aus Recyclingmaterialien, die an die Inhalte der pädagogischen Module angelehnt sind. Die Kinder erleben Technik altersgerecht und nutzen die entstandenen Artefakte, um den Kids Cube – einen modularen Holzwürfel – sinnvoll zu ergänzen und ihren Lern- und Spielbereich innerhalb der Unterkunft aufzuwerten.
Artefakt: Technikobjekte aus Recyclingmaterialien – abgestimmt auf die Themen der Bildungsmodule.
Kooperation: AWO Stuttgart. Thano & Edith (Projektleitungen Kids Cube)
Ansprechpersonen: Prof. Dr. Marc Kuhn, Prof. Dr.-Ing. Harald Mandel, Flavia Milachay
SDGs: 10, 11, 12, 16
Challenge: Wie kann Künstliche Intelligenz helfen, nachbarschaftliche Unterstützung im Alltag niedrigschwellig zu fördern – insbesondere für Senior:innen oder Menschen mit Unterstützungsbedarf? Gesucht wird ein KI-gestützter Lösungsansatz, der tatsächliche Bedarfe erkennt, passende Hilfe lokal vermittelt und dabei auf einfache, akzeptierte Technologien (z. B. Sprachassistenten oder Smartphones) setzt.
Ziele: Analyse bestehender digitaler Nachbarschaftsplattformen und ihrer Zugangshürden. Entwicklung eines smarten, lokal einsetzbaren Prototyps, der Hilfsbedarfe automatisch oder halbautomatisch erkennt (z. B. Einkaufs- oder Hilfsbedarf, soziale Isolation) und mit passenden lokalen Angeboten oder Nachbar:innen vernetzt – mit Fokus auf Zielgruppen mit geringer digitaler Kompetenz.
Artefakt: Ein Konzept und Prototyp einer barrierearmen KI-Anwendung zur Nachbarschaftshilfe – basierend auf realen Bedarfsanalysen. Optional mit Integration einfacher Smart Home-Komponenten (z. B. Sprachsteuerung) und Erprobungsszenario im Smart Living Lab Heilbronn.
Kooperation: Projekt CITAI (Madeleine Neumann)
Ansprechperson: Prof. Dr. Marc Kuhn
SDGs: 3, 5, 10, 16
Challenge: Wie begegnen wir Menschen mit Trauma, Behinderung, Flucht- oder Verlusterfahrung – jenseits von Mitleid, mit echtem Verständnis, Menschlichkeit und Handlungskompetenz? Gesucht wird ein multimediales Aufklärungsformat, das Geschichten hörbar macht, Perspektiven weitet und zum Umdenken bewegt – emotional, interaktiv und mitten aus dem Leben.
Ziele: Gestaltet ein veröffentlichungsreifes E-Book, das bewegende Erfahrungsberichte mit fundiertem Fachwissen und konkreten Handlungstools vereint, auf Basis echter Gespräche mit Betroffenen und Expert:innen. Optional ergänzt wird euer Werk durch ein Lernspiel (digital oder haptisch), das Empathie erlebbar macht – für den Einsatz in Teams, Schulen, Familien oder der beruflichen Bildung. Ihr arbeitet praxisnah mit einem Sparringspartner und habt die Chance, euer Projekt öffentlich zu präsentieren – als Co-Autor:innen, Creator:innen und Change-Maker.
Artefakt: Ein marktreifes E-Book mit starker visueller Sprache, inklusive Branding und Marketingstrategie. Ergänzend: ein Lernspiel zum Perspektivwechsel, optional erweitert durch digitale Module wie eine Landing Page, Podcast-Trailer oder Webinhalte – offen für kreative Beiträge in Storytelling, Content Creation oder Community-Building.
Kooperation: Verlage und DHBW Repositorium, Plattformen für soziale Innovation
Ansprechperson: Robert Lahdo
SDGs: 4, 14, 15
Challenge: Eine Virtual-Reality-Anwendung können Nutzer:innen durch Immersion interaktive Erlebnisse in regionale Ökosysteme ermöglichen und sie für den Schutz heimischer Tier- und Pflanzenarten sensibilisieren. In zielgerichtet gestalteten virtuellen Landschaften – etwa Wäldern, Alpenregionen oder Gewässern – werden ökologische Zusammenhänge, Artenschutzmaßnahmen sowie die Folgen des Klimawandels erlebbar gemacht. Die Anwendung soll das Bewusstsein für Biodiversität stärken und als innovatives Bildungsmedium für Schulen, Hochschulen und Umweltorganisationen dienen.
Ziele: Konzeption, (Weiter-)Entwicklung einer VR-Anwendung, die das Bewusstsein für regionale Biodiversität stärkt, Wissen über heimische Arten vermittelt und ökologische Zusammenhänge erfahrbar macht.
Artefakt: Interaktive VR-Szenarien z.B. Artenkenntnis, Renaturierung und Klimawandelfolgen – optional ergänzt Lehr-/Lernmaterial
Kooperation: Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit (Dr. Denis Pijetlovic)
Ansprechpersonen: Prof. Dr. Andrea Honal, Judit Klein-Wiele
SDGs: 3, 15
Challenge: Tiere, die ein Leben lang für den Menschen gearbeitet haben, verdienen einen Lebensabend in Würde. Die Herausforderung dieser Challenge besteht darin einen innovativen Ansatz zu entwickeln um ehemaligen Nutz-, Arbeits- oder Zirkustieren ein artgerechtes, sicheres und erfülltes Leben im Ruhestand zu ermöglichen – mit Blick auf Nachhaltigkeit, Tierwohl und gesellschaftliche Verantwortung.
Ziel: Gestaltung und Erprobung einer Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität von Tieren im Ruhestand – sozial, ökologisch, ethisch fundiert und technisch unterstützt.
Artefakt: Ein Konzept oder ein Prototyp für eine zukunftsfähige Lösung zur Haltung, Versorgung oder Integration von Tieren im Ruhestand zur Erprobung auf einem Gnadenhof.
Kooperation: Vorschläge: Gnadenhof, Zoo, Bauernhof, Bauernverband, Krone Farm
Ansprechperson: Dr. Marcella Rosenberger
Teilnahme und INDIS-Unterstützung
Innovative Methoden & Workshop-Sessions
Das Angebot besteht aus verpflichtenden Events in Präsenz:
- Kick-off-Event 10.10.-12.10.2025 auf der Burg Liebenzell
- Zwischenevent 25.02.2026
- Abschlussevent im Juni/Juli 2026
und monatlichen Online-Sessions. Diese Sessions finden jeden dritten Dienstag im Monat zwischen 18 Uhr und 20 Uhr (Änderungen vorbehalten) statt.
Sessionbausteine können aus den folgenden Bereichen übernommen werden:
- Methodenkompetenzen und Projektmanagement
- Medien und Design
- Programmierung und KI
- Forschungsmethoden
- Themen aus allen Disziplinen und der Praxis
- etc.
Deep Dive Sessions in Präsenz
- z.B. Exkursionen, besondere Workshops, Planspiel/Simulation, Werkstattformate, Raum für tiefgehende Diskussionen, individuelle Fragen und gezielte Unterstützung
- Informationen und Termine werden noch bekannt gegeben
Benefits
- New Work: Erlernen wichtiger Zukunft-Skills
- individuelle und nachhaltige Betreuung durch INDIS-Coaches
- Networking und INDIS-Community
- Leistungsnachweis durch INDIS-Zertifikat oder ECTS-Anerkennung in Abstimmung mit der Studiengangsleitung
INDIS-Challenges - Zur Anmeldung
Interesse? Mit der Anmeldung können Sie bis zum 15.09.2025 einen Challengewunsch äußern. Weitere Informationen zum Startzeitpunkt, zu Terminen etc. erhalten Sie entweder auf Nachfrage per Mail oder nach Ihrer Anmeldung. Das Formular dazu finden Sie auf der Seite Anmeldung zu den INDIS-Challenges.
Kurze Informationen zum INDIS-Zyklus 2025/26 auf einen Blick

gefördert durch:
copyright-Hinweis für die UN icons
Sustainable development goals - Guideline (PDF) for the use of the SDG logo, including the colour wheel, and 17 icons.

